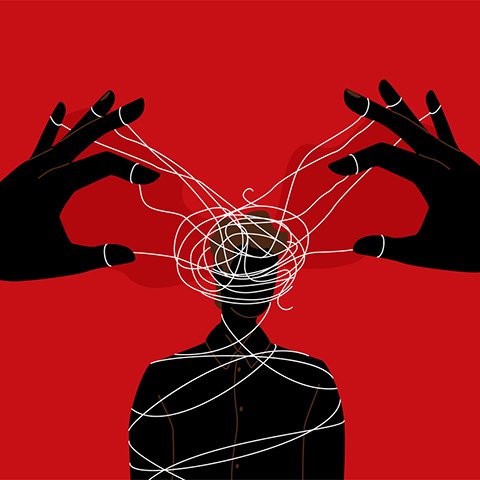Nach Jerome Powell ist Kevin Warsh der zweite FED-Chef, der von Präsident Trump nominiert wird. Die Nominierung des FED-Chefs ist verfassungsmäßiges Recht des Präsidenten selbst, die Bestätigung durch den Senat erforderlich, aber in der Regel eine Formsache. Doch der Rahmen ist diesmal anders. Obgleich Warsh in den Wettbüros fast nie Spitzenreiter war, konnten wir ihn uns gut vorstellen. In meinem letzten Newsletter hatte ich geschrieben, dass ich Kevin Warsh vor dem damalig führenden Kevin Hasset sehe. Das lag nicht daran, dass Warsh selber seit fast 15 Jahren für den Job an der Spitze lobbyiert hat. Sondern daran, dass er von außen sehr gut in das Schema passt, das sich seitens des aktuellen Präsidenten in der Besetzung von Jobs abzeichnet: Er hat eine, zumindest oberflächlich gesehene, Qualifikation für den Job, er weist eine starke Verbundenheit zur Republikanischen Partei auf, er steht nicht im Verdacht, dem „Obama-Camp“ nahezustehen, er ist international vernetzt und, um das ein wenig provokativ zu formulieren, er kommt aus einem „Milliardärsumfeld“ und hat damit in der aktuellen Administration so etwas wie „Stallgeruch“.
Gehen wir die einzelnen Punkte kurz durch. Der 1970 geborene Kevin Warsh wurde 2006 zum jüngsten Mitglied des FED-Boards, er wurde durch George W. Bush nominiert und trat 2011 zurück. Dies tat er in der ersten Amtszeit Barack Obamas, einige Beobachter sahen dies als eine Positionierung auf einen Wahlsieg von Mitt Romney. Warsh war unter anderem Executive Secretary of the Economic Council unter dem zweiten Bush, FED-Vertreter in den G20, Mitglied der Group of Thirty, um nur einige zu nennen, ist also politisch sehr gut vernetzt. Gesellschaftlich ist er das auch: Verheiratet mit einer Erbin des Estée Lauder-Konzerns kann er sich auch im Zirkel der US- Milliardäre heimisch fühlen.
Dass die FED ein „Objekt der Begierde“ der neuen Administration ist, war von Beginn an klar. Weniger die Institution an sich, sondern mehr die implizite wirtschaftliche Macht der Institution und der Einsatz dieser Macht im Sinne der ökonomischen Vorstellungen des neuen wirtschaftlichen Teams im Weißen Haus. Insofern würde ich es als Illusion ansehen, dass diese Gedanken bei der Nominierung von Warsh keine Rolle gespielt hätten. In der gegenwärtigen Konstellation warten verschiedene Herausforderungen auf den neuen FED-Chef und die geldpolitischen Entscheidungen sind nur eine von ihnen. Ich zähle die wichtigsten davon auf:
# 1: Installationsprozess und Stellung im FED-Board
# 2: Positionierung für/gegen die FED-Kollegen im Board
# 3: Fachliche Akzeptanz von Kevin Warsh im FED-Board
# 4: Findung einer geldpolitischen Position
# 5: Erwartungen der Administration
Gehen wir die einzelnen Punkte im Folgenden durch.
# 1: Installationsprozess und Stellung im FED-Board
Die erste Frage, die sich stellt, ist die, wann denn Kevin Warsh seine Arbeit im FED-Board aufnehmen wird. Die Trump-Administration hat zwei juristische Verfahren gegen Mitglieder des aktuellen FED-Boards laufen. Das eine ist gegen Governor Lisa Cook, das andere ist eine Untersuchung gegen FED-Chef Powell, die mit einer „Subpoena“, also einer Vorladung, in der zweiten Januarwoche eingeleitet wurde. Zu den Details später. Relevant für Kevin Warsh ist aber, dass Senator Thom Tillis, Republikaner aus North Carolina, der sich nicht zur Wiederwahl stellt und damit druckunempfindlicher ist als manche seiner Kollegen, verkündet hat, dass er die Bestätigung von Warsh nur dann unterstützen wird, wenn das Verfahren gegen Powell abgeschlossen ist. Tillis sitzt im Senate Banking Committee und könnte, wenn er mit den Demokraten abstimmt, jede Weiterleitung zu einer Abstimmung im Gesamtsenat blockieren.
Ohne die Bestätigung vom gesamten Senat kann aber Kevin Warsh seine Tätigkeit als FED-Chef nicht aufnehmen. Dass die US-Administration hier ein Risiko sieht, lässt sich daran ablesen, dass Stephen Miran, dessen Amtszeit am 31. Januar geendet hat und der der Platzhalter der Administration für den neuen FED-Chef war, nicht aus dem FED-Board ausscheidet, sondern eine Übergangsregelung zieht, dort bis zur Bestätigung seines Nachfolgers, in diesem Falle von Kevin Warsh, zu bleiben. Dafür hat er sogar seinen „ursprünglichen“ Job als Chef des Council of Economic Advisers im Weißen Haus aufgegeben.
Jerome Powell hat drei Rollen, die normalerweise jeder FED-Chef hat, die aber nicht zwingend zusammengehören müssen. Zum einen ist er berufenes Mitglied im FED-Board. Hier geht seine Amtszeit noch bis 2028. Daneben ist er FED-Chef. Diese Position würde er dann an Warsh im Mai abgeben, sofern Warsh bis dahin vom gesamten Senat bestätigt ist. Zum dritten ist er Vorsitzender des FOMC, also des Federal Open Market Committees, welches über die US-Geldpolitik entscheidet. Diese Position, die innerhalb des Gremiums gewählt wird, wird üblicherweise mit dem amtierenden FED-Chef besetzt, das ist aber kein Muss. Und, so kann man das aus dem Mitte Februar veröffentlichten Protokoll der letzten FOMC-Sitzung von 27./28. Januar 2026 entnehmen, Jerome Powell ist gerade für die Periode eines Jahres erneut zum FOMC-Chair gewählt worden. Es liegt damit in seiner Hand, diese Position an Kevin Warsh abzugeben – oder eben nicht. Wenn Kevin Warsh dann in das FED-Board einzieht, ist er so etwas wie der “FED-Chair in waiting“, bis zum Mai aber nicht mehr als ein einfaches Board-Mitglied und auch bis mindestens dahin nur ein normales FOMC-Mitglied. Einer von zwölf, die dann über die Geldpolitik entscheiden werden, doch noch niemand, der sie nach außen kommuniziert.
Die Resonanz auf Warsh im FED-Board dürfte ebenso unterschiedlich sein, wie die der Beobachter von außen. Manche halten Warsh wegen seiner Vernetzungen für eine ideale Wahl und haben, wie der Chicago FED-Präsident Goolsbee, schon angekündigt, sich zu freuen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Andere, wie Governor Waller, werden noch an ihrer Niederlage leiden und der ein oder andere mag sich im schlimmsten Fall die Sicht von Paul Krugman zu eigen machen (überliefert “he’s an operator who says things that sound smart unless you pay attention”). Dass man in ihm den Heilsbringer sieht wie in Bernanke, kann, denke ich, ausgeschlossen werden. Er wird sich in diesem Gremium sein Standing erarbeiten müssen.
# 2: Positionierung für/gegen die Kollegen im Board
Eine erste Positionierung, die auch sein Standing betreffen wird, ist, wie er sich gegenüber seinen Kollegen im FED-Board verhält, die von der Administration unter juristischen Druck gesetzt werden. Warsh hat es im Besetzungsprozess vermieden, sich dazu zu äußern, anders als beispielsweise die Kollegen der Europäischen Zentralbank und anderer Notenbanken. Dieses Abtauchen mag eine gute Strategie für den Besetzungsprozess gewesen sein, als Mitglied des Boards wird diese Strategie schwieriger, als FED-Chef unmöglich.
Ich will hier nochmal die zwei Fälle aufgreifen. Was liegt gegen Powell vor? Nun, bei der Renovierung von FED-Gebäuden sind die Kosten deutlich höher ausgefallen als geplant war. Zudem wirft die Administration Powell vor, in einer Senatsanhörung dazu bewusst die Unwahrheit gesagt zu haben. Geleitet wird das Verfahren gegen ihn durch die von der neuen Administration berufene Washingtoner Staatsanwältin Jeanine Pirro, ehemalig eine Kommentatorin von Fox News, einer anderen geschätzten Quelle für Stellenbesetzungen der gegenwärtigen Administration. Aus diesem Grunde hat das Department of Justice ein Strafverfahren gestartet und Powell eine Vorladung („Subpoena“) zugestellt.
Powell, sonst eher zurückhaltend in seinen Stellungnahmen, reagierte außerordentlich hart und entschlossen, was aus meiner Sicht nicht nur verständlich, sondern auch geboten war, ist doch eine strafrechtliche Untersuchung gegen einen amtierenden FED-Chair einmalig. Er veröffentlichte eine kurze Videobotschaft, die die strafrechtliche Verfolgung als unbegründet und in der Intention als Druckmittel brandmarkte, niedrigere Leitzinsen zu erzwingen. Powell signalisierte auch, dass er sich diesem Druck nicht beugen werde. In kurzer Folge veröffentlichten internationale Notenbanken unter der Führung der EZB eine Vertrauensbekundung zu Powell und der eingangs erwähnte Thom Tillis signalisierte Bereitschaft, die Berufung von Warsh hinauszuzögern, etwas, was er, wie ich glaube, allerdings nicht durchhalten wird.
Der zweite Fall ist der von Fed-Governor Lisa Cook. Sie war die erste FED-Gouverneurin, die aus wichtigem Grund („for cause“) entlassen wurde, weil die Administration ihr falsche Angaben in einem Antrag auf einen Immobilienkredit aus einer Zeit vor ihrer Berufung zur FED-Gouverneurin vorwirft. Sie klagte und darf zunächst im Board bleiben. Der Fall wird derzeit am Obersten Gerichtshof verhandelt. Bei der ersten Anhörung im Januar war FED-Chef Powell als Zuhörer zugegen und er bewertete dieses Verfahren als das vielleicht wichtigste in der Geschichte der FED. Ich gebe ihm recht, denn mit diesem Verfahren wird festgestellt werden, was denn für einen triftigen Grund ausreicht, um ein Mitglied der unabhängigen Notenbank seitens des Präsidenten abzuberufen. Kritik an seiner Anwesenheit bei der ersten Anhörung begegnete Powell mit Verweis, dass auch der ehemalige FED-Chef Paul Volcker einem Verfahren als Zuhörer beiwohnte.
Ich erwarte nicht, dass sich Kevin Warsh so entschlossen positionieren wird wie Powell, ich denke, er wird sich wegducken. Dies dürfte sein Standing als Verfechter der FED-Kredibilität beschädigen und sein Agieren im FED-Board nicht einfacher machen. Ich erwarte nicht, dass Powell aus dem Board zurücktritt, wie FED-Chefs vor ihm, solange die strafrechtliche Untersuchung läuft – das hat er angekündigt und das ist sein bestes Verteidigungsmittel. Die Position von Warsh im Board wird dadurch aber eher schwieriger.
# 3: Fachliche Akzeptanz von Kevin Warsh im FED-Board
Schaut man sich den Lebenslauf von Kevin Warsh an, ist das nicht unbedingt der eines klassischen Notenbankers. Sein B.A. in Public Policy von Stanford und sein J.D. in Law von Harvard kommen zwar von äußerst renommierten Universitäten, umfassen aber sicher keine tiefgehende volkswirtschaftliche oder Bankenausbildung. Von daher war die Berufung von Warsh 2006 in das FED-Board umstritten. Der frühere Vize-Präsident der FED Preston Martin nannte seine Nominierung „not a good idea“. Dagegen verwies Ben Bernanke in seinen Memoiren auf seine Verdienste im Zuge der Lehman-Krise und seine wertvollen Kontakte in die New Yorker Finanzszene. Seit seinem Ausscheiden aus dem damaligen FED-Board 2011 hat Warsh ein wenig das Profil eines Libertären, Gegner von Quant Easing, Advocatus Diaboli, Verfechter der FED-Unabhängigkeit aufgebaut.
Durch wissenschaftlich führende Arbeiten ist er aber nicht hervorgetreten, genauso wenig wie durch Spitzenpositionen in wichtigen Finanzunternehmen. Und seine Thesen waren nicht immer konsistent, zuletzt eher fließend. Einerseits gewann er den Ruf, den „Hawks“ näher zu stehen, weil er für eine Reduktion der Notenbankbilanz argumentierte. Kürzlich argumentierte er für schnelle Zinssenkungen, weil er der Entwicklungsdynamik in der Künstlichen Intelligenz (im Folgenden AI, „Artificial Intelligence“) künftige Produktivitätszuwächse zubilligte, die disinflationär wirken. Und er sprach sich für geringere Frequenzen der Kommunikation und weniger „Data Dependency“ aus.
Abgesehen davon, ob denn Produktivitätsdaten, die oft einen hohen zeitlichen Verzug haben, zur Steuerung von Geldpolitik ein wirklich geeignetes primäres Instrument sind, zeigen zwei jüngste Positionierungen von FED-Mitgliedern, dass dieser einfache Weg zur Rechtfertigung von Zinssenkungen schwerlich von allen gekauft werden wird. FED-Governor Barr hielt am 17. Februar einen sehr differenzierten Vortrag zur AI und deren Auswirkungen für Arbeitsmarkt und Wirtschaft bei der New Yorker Association for Business Economics. Er machte verschiedene Pfade der möglichen Auswirkungen und Effekte von AI auf, stimmte also nicht in ein vereinfachtes „AI führt zu höherer Produktivität und damit zur Möglichkeit niedrigerer Zinsen“ ein. Die Chefin der San Francisco FED, Mary Daly, ging sogar argumentativ in eine andere Richtung, sie sah es als Möglichkeit, dass AI letztendlich zu einer höheren „neutralen Rate“ der Notenbank führen kann, weil Produktivitätsgewinne auch von höherer Lohndynamik begleitet werden könnten.
Mein Resümee ist: Warsh wird sicherlich nicht als fachlich unbestritten angesehen werden wie Bernanke oder Yellen, sondern wird sich seine inhaltlich Position erarbeiten müssen – und ob er das kann, bleibt für mich offen.
# 4: Findung einer geldpolitischen Position
In der jüngsten Pressekonferenz hat Powell noch einmal das duale Mandat der FED betont: Inflation im Zaum halten und Weichenstellungen für Vollbeschäftigung. Das von den Vertretern des Trump-Lagers ins Spiel gebrachte dritte FED-Ziel, moderate langfristige Zins-sätze, hat er bewusst weggelassen. Das war das Signal, dass das FED-Board sich diese Überlegungen von Miran und Hassett nicht zu eigen macht. Nimmt man die aktuelle Situation, so ist die Inflation gemessen am PCE – das ist das relevante Maß für die FED, nicht der Verbraucherpreisindex CPI – mit 2,9 Prozent im Dezember 2025 weiterhin deutlich über der Zielmarke von 2 Prozent. Gleichzeitig ist die Arbeitslosenrate in den letzten beiden Monaten wieder zurückgegangen und lag mit 4,3 Prozent im Januar 2026 nicht auf besorgniserregenden Niveaus. Zeichen eines Einbruchs des Arbeitsmarktes waren zuletzt nicht zu erkennen, auch die FED sprach bei ihrer letzten Sitzung im Januar eher von einer Stabilisierung. Aus unserer Sicht ist der US-Arbeitsmarkt aktuell durch ein „Low hire, low fire“-Umfeld gekennzeichnet. Dies spricht eher nicht für aggressive Zinssenkungen am aktuellen Rand, im Gegenteil, das Zusammenspiel aus Inflation und Arbeitsmarkt lässt mich eher zu dem Schluss kommen, dass die Senkung im Dezember 2025 die letzte in Powells Term als FED-Chef war, etwas, was die Märkte über die letzten Wochen nun auch einpreisen.
Gegeben einer ordentlichen wirtschaftlichen Dynamik dürfte es mehr Spielraum für Zinssenkungen erst bei stärker rückläufiger Inflation geben, also wenn die zollbedingten Basiseffekte auslaufen. Mir fehlt hier ein überzeugendes Argument von Warsh für schnelle Zinssenkungen und insofern denke ich, wird er sich im FED-Board nicht durchsetzen können. Das Board in der jetzigen Zusammensetzung wird in meiner Erwartung für eine traditionelle Geldpolitik optieren. Von daher erwarte ich weitere, aber nur graduelle Schritte im späteren Jahresverlauf.
# 5: Erwartungen der Administration
Kevin Warsh wird mit Scott Bessent und Kevin Hassett starke Gegenüber in der Treasury und dem Weißen Haus haben, daneben einen Präsidenten, der Geduld nicht als eine Tugend betrachtet. Bessents Andeutungen, er könne notfalls lange Rentenpapiere kaufen und über kurze T-Bills refinanzieren, geben ein Indiz, ebenso wie seine Bereitschaft, in Währungsfragen aktiver zu werden – siehe seine Kursabfragen bei führenden Banken bei der letzten Yen-Schwäche. Und laut Berichten der Financial Times hat Kevin Hassett jüngst gefordert, dass die Volkswirte der NY FED bestraft werden sollten, weil sie einen Bericht darüber veröffentlichten, wie die Zölle die US-Verbraucher und Unternehmen belasteten.
Präsident Donald J. Trump, mit einem Auge auf den Midterm Elections im November, wird sicherlich nicht mit einer oder zwei Zinssenkungen zufriedenzustellen sein. Zu erwarten ist, dass er im Besetzungsprozess Warsh mehrfach darauf angesprochen hat, und, wenn Warsh gesagt hätte, er könne nur einmal, maximal zweimal 25 Basispunkte Zinssenkungen verantworten, wäre er meines Erachtens nicht vom Präsidenten nominiert worden. Was also, wenn Warsh nicht liefert oder nicht liefern kann? Wird er seine Überzeugungen wechseln, wenn er im Office ist, so wie wir das bei einigen in der Administration gesehen haben? Von Tulsi Gabbard bis Pam Bondi, eingeschränkt selbst bei Scott Bessent. Oder wird er aufrecht zu stehen versuchen gegen eine Naturgewalt, die der aktuelle Präsident zweifelsfrei ist.
Ich kann mir hier nicht vorstellen, dass Warsh dem Druck standhält, der Vorteil, in der Administration nahe stehenden Milliardärskreisen zu sein, kann sich hier als Nachteil entpuppen, weil er dem Druck wahrscheinlich ständig ausgesetzt sein dürfte, auch während „privater“ Meetings. Und wenn er das FED-Board inhaltlich nicht auf seine Seite bringt, was bleibt ihm? Eine richtig schwierige Situation mit dem Potenzial, dass Warsh eine tragische Figur wird.
Implikationen für den Anleger
Die US-Notenbank wird einer der Haupteinflussfaktoren auf die Kapitalmärkte bleiben. Die Berufung von Kevin Warsh dürfte nicht das Ende eines Gerangels um die Zinspositionierung der Notenbank sein, sondern der Anfang einer noch intensiveren Debatte. Dass es Kevin Warsh gelingen wird, die Institution ruhig durch die politischen und ökonomischen Herausforderungen zu navigieren, bezweifle ich. Damit dürfte die FED ihre Rolle als Stabilitätsanker eingeschränkt sehen.
Ob Warsh das aktuelle FED-Board hinter sich bringt, ist eine wesentliche Frage. Ich bezweifele es kurzfristig, vielleicht hat er mittelfristig bessere Chancen. Ich erwarte nicht, dass ohne signifikante Veränderung des augenblicklichen FED-Boards die FED 2026 in einer Geschwindigkeit senken wird, wie es der US-Präsident sich wünscht, sondern sich eher an den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen orientieren muss. Das spricht für eine, eventuell zwei Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte im Jahr 2026, wenn der Inflationsrückgang stärker durchschlägt. Dies alles unter der Voraussetzung, dass eine militärische Auseinandersetzung am Golf nicht noch die Karten völlig neu mischt.
Warshs Intention von weniger Kommunikation und weniger „Data Dependency“ dürfte, wenn er das durchsetzen kann, eher für noch mehr Volatilität sorgen. Die Idee, die Bilanz der FED weiter zu verkleinern, dürfte zunächst an „handwerklichen“ Restriktionen scheitern. Kann er das lösen, mag es etwas mehr Spielraum für die kürzeren Zinsen nach unten geben, der Druck auf die langen Zinsen würde aber eher steigen.
Gerade weil Warsh in seinen Kommentaren nicht eine kontinuierliche und überzeugende Linie verfolgt und die Administration schnelle Erfolge sehen will, wird nicht nur die US-Administration Warsh testen, sondern auch die Finanzmärkte. In der Vergangenheit wollten die Finanzmärkte immer wissen, wie sie es mit dem FED-Chef zu halten haben. Die Wall Street hat die neuen FED-Chefs getestet, nahezu jeder in den letzten Jahrzehnten war nach Amtsantritt damit konfrontiert, dass die Börse innerhalb der ersten sechs Monate der Amtszeit Ausreißer nach unten hatte, das Extrembeispiel war sicher Alan Greenspan mit dem Crash 1987.
Ob der Test für Warsh am Aktienmarkt kommt, oder vielleicht auch am Rentenmarkt, wird man sehen. Aber ich denke, er wird von den Märkten getestet werden. Erfüllt sich meine Basisannahme, dass das FED-Board eine im Wesentlichen traditionelle Politik durchsetzen wird, sollte die FED weiterhin eine stabilisierende Funktion auf die Märkte ausüben, auch wenn ich erwarte, dass die der Warsh-FED geringer als die der Bernanke- oder Yellen-FED sein wird. Die Risiken sind allerdings asymmetrisch. Das Risiko, dass Warsh unter dem Druck einbricht und die Kredibilität der Institution beschädigt, sehe ich weit höher an als das, dass er die Kredibilität der Institution noch weiter stärken kann.